So nah, so fremd
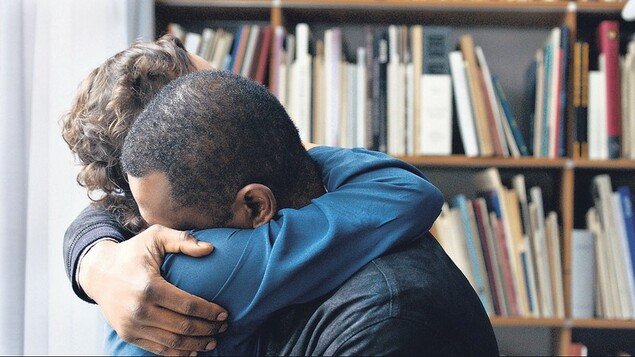
Einmal, erzählt Joseph, habe er die Harley Davidson von Mobutu gestohlen. In der Stammkneipe der Migranten nennen sie ihn den Prinzen, wer weiß, vielleicht ist er tatsächlich adeliger Herkunft. Ich bin Geschäftsmann, Import Export, lautet seine Selbstauskunft, in seiner Hosentasche trägt er kleine Diamanten mit sich herum, in Papier eingewickelt.
Sie stammen von seinem Grundstück im Kongo, sagt er, und dass er dort eine Mine eröffnen möchte. Dafür braucht er Geld, Investoren – nicht einfach, wenn die deutschen Behörden ihm rote Briefe wegen seines Aufenthaltsstatus’ schicken.
Oder ist Joseph „nur“ ein Bürgerkriegsflüchtling in Frankfurt am Main, dem die deutsche Bürokratie das Leben schwer macht und der in windige Geschäfte und Deals mit dubiosen Freunden verwickelt ist – notgedrungen, wegen der Schulden? Manchmal verschwindet er tagelang, oder er landet im Gefängnis.
Wo gehst du hin?, will Monika irgendwann wissen, die Ausstellungskuratorin, die sich in Joseph verliebt hat. „I need to think“, antwortet er. Sie reden Englisch, in knappen Sätzen, keine leichte Verständigung.
Die in Berlin lebende Filmemacherin Lisa Bierwirth, die nach ihrem Dffb-Studium unter anderem bei Valeska Grisebachs Sozialdrama „Western“ als Beraterin und Assistentin arbeitete, belässt es in ihrem Regiedebüt „Le Prince“ konsequent bei der Außenperspektive auf Joseph. Über den Mann aus dem Kongo, gespielt vom französischen Rapper Passi Balende, erfährt die Zuschauerin nicht mehr als Monika. Die Fragen und Zweifel der Kuratorin (Ursula Strauss, in Österreich ein Film- und TV-Star) sind auch die des Publikums.
Bei aller Zuneigung und Hilfsbereitschaft wird nach und nach deutlich: Auch die weltoffene Monika ist nicht frei von Ressentiments, erst recht nicht die Kunst- und Kulturschickeria um sie herum (darunter Viktoria von Trauttmansdorff als Freundin, Hanns Zischler als Sammler). Sie bietet an, ihn wegen der Papiere zu heiraten, sie will seine Schulden auslösen, 10 000 Euro. Aber er will etwas anderes, nämlich Respekt: „Mein Vater wurde kolonisiert. Ich nicht.“
Eine verrückte Begegnung: Die Mittvierzigerin hat gerade erfahren, dass ihr Chef bei der Frankfurter Kunsthalle bald geht, ihr Job ist nicht mehr sicher. Genervt verlässt sie die Vernissage, braucht eine Zigarette, landet in einer Migrantenkneipe im Bahnhofsviertel unweit der Kunstmeile – und versteckt sich bei einer Razzia zusammen mit einem Kneipenbesucher. Flüsternd stellen die beiden sich vor, höflich, erstaunt – so fängt es an.
[Wenn Sie die wichtigsten Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]
Die aus dem Hessischen stammende Bierwirth hat ihr Debüt mit Maren Ades Berliner Produktionsfirma Komplizen Film realisiert, Ausgangspunkt war die Ehe ihrer Mutter mit einem Mann aus der Republik Kongo. Eine weiße Frau, ein schwarzer Mann: ein mutiges, gegen Konventionen und Widerstände kämpfendes Paar. Im Film bleiben es zwei Welten, gegeneinander geschnitten: hier die leidenschaftlich über Afrika politisierenden Migranten, dort der Kultursmalltalk, als Monika sich selber auf die Leitung der Kunsthalle bewirbt.
[OmU: Ab Donnerstag in den Berliner Kinos Bb-ware!Ladenkino, fsk , Hackesche Höfe, Tilsiter-Lichtspiele, Wolf]
Oft ist es Nacht, oft begleitet die Kamera die Protagonisten bei ihren Gängen durch die Stadt, zeigt sie in der Rückenansicht – wobei der Film die unterschiedlichen Frankfurter Milieus und Architekturen weitgehend anhand von Interieurs verdeutlicht. Eine Bildästhetik entwickelt Bierwirth daraus nicht.
Die Beklemmung des Films entspricht der gesellschaftlichen Beklemmung
Szenen reißen ab, Intimität und Sex bleiben angedeutet, was die beiden aneinander fasziniert, worüber sie gemeinsam lachen, man erfährt es nicht. Ich bin nicht dein Feind, sagt Monika einmal. Manchmal kippt der lapidare Stil auch ins Belanglose, Ungelenke. Kleine kostbare Szenen wie jene, als Monika beim ersten Besuch in Josephs bescheidener Bleibe Blumen mitbringt und eine Plastikflasche zur Vase umfunktioniert werden muss, sind die Ausnahme.
Bierwirth vermeidet jede Psychologisierung und vordergründige Politisierung. Das ist das Gute an ihren verhaltenen, auch befangen wirkenden Bildern: Sie verleihen der gesellschaftlichen Beklemmung Ausdruck. „Le Prince“ ist ein Film über die Unzulänglichkeiten, wenn es hierzulande um Rassismus geht. Das Problem ist die Reproduktion dessen, was in der Kritik steht: Der Mann aus dem Kongo bleibt Objekt, eine Projektionsfigur.

